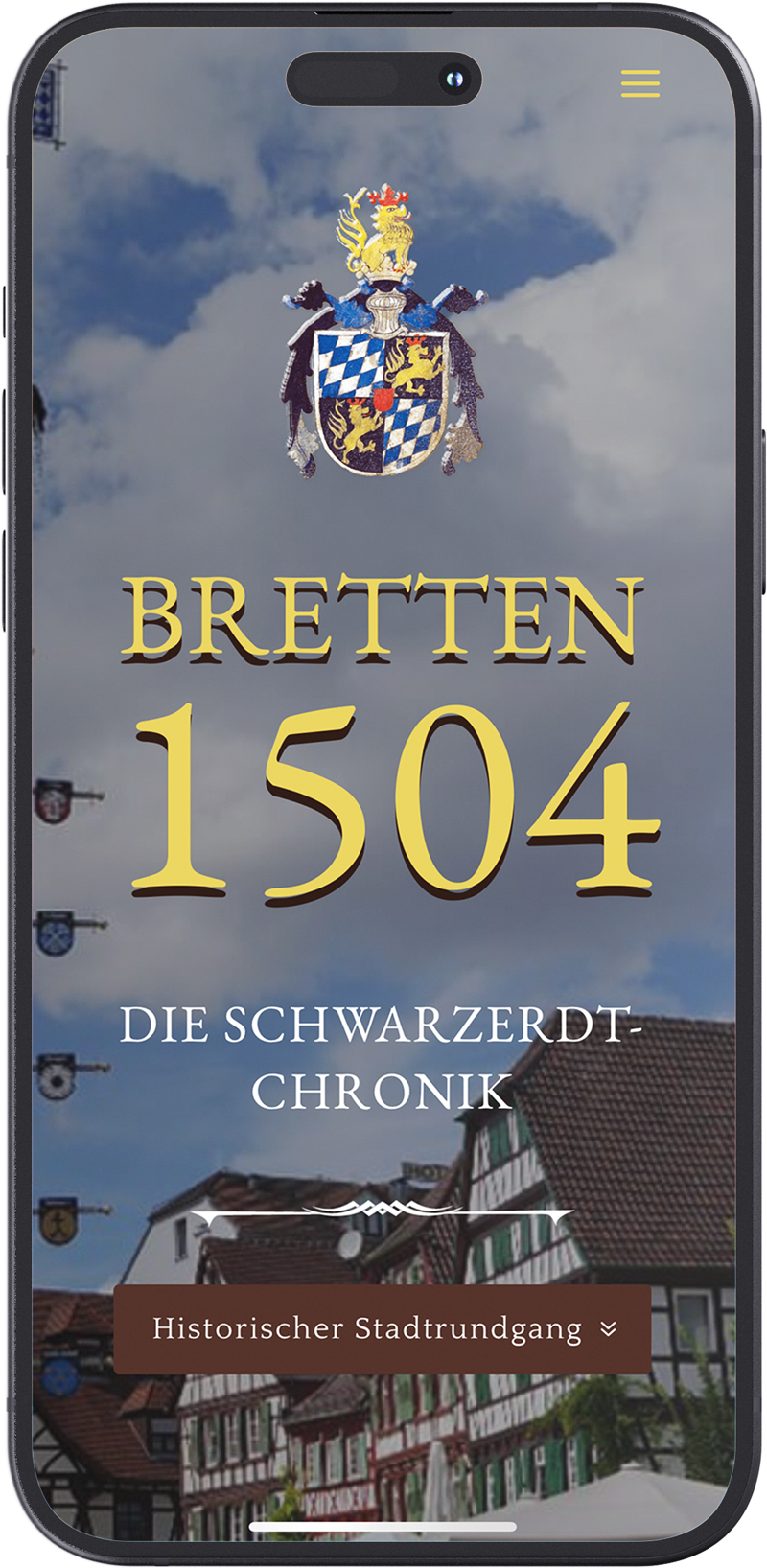Wegpunkte
1. Schanze
In der Folge des Landshuter Erbfolgekrieges hatte Herzog Ulrich von Württemberg der Kurpfalz den Krieg erklärt, griff Brettheim an und belagerte es. Die Stadt hatte große strategische Bedeutung als Kreuzungspunkt zweier wichtiger Handelsstraßen.
Am 11. Juni 1504 zog er mit einem Heer von etwa 30.000 Mann nach Bretten, um diese Stadt einzunehmen. Er kam aus Richtung Gölshausen und ließ in kürzester Zeit eine große Schanze auf der Höhe im Nordosten der Stadt errichten. Von dort aus begann er mit schweren Geschützen die Stadt so heftig zu beschießen, dass „die ganze Stadt erbebte. Man konnte vor lauter Staub, Rauch und Dampf den anderen kaum mehr sehen“, heißt es in der Chronik.
2. Weißhofer Tor
Hier kamen durch den Beschuss der Belagerer auch zwei Landsknechte zu Tode, was in der Folge zu einem Aufstand und fast zur Meuterei geführt hätte.
Weil man am Weißhofer Tor am ehesten einen Durchbruch der Württemberger erwartete, bauten die Verteidiger dort eine Fallgrube. Das Innere dieses Grabens war mit angespitzten Zaunpfählen, die gegeneinander zeigten, gespickt. Dazwischen lagen mit Schwefel und Pech getränkte Strohräder, die man bei einem Durchbruch sofort hätte anzünden können. Zusätzlich wurde eine große Anzahl von Fußeisen gelegt. Damit sah man sich bestens gerüstet für den Fall der Fälle.
3. Simmelturm
Der Simmelturm war der südlichste Punkt der Stadtbefestigung. Er wurde zwischen 1350 und 1400 erbaut, ist auf Eichenpfählen gegründet und diente als Gefängnis. Am Bogenfries sind neben verschiedenen Wappen sechzehn Fratzenköpfe zu sehen, zur Abschreckung. Die runde Form des Turmes gab ihm seinen Namen (sinwel oder simmel bedeutet rund).
Am Simmelturm vorbei führte eine wichtige Handelsstraße von Ulm in die Stadt. Wegen des Krieges aber waren die Straßen wie leergefegt und keine Handelswaren kamen nach Brettheim und auch keine Stoffe. So entwickelte sich in jenen Tagen in Brettheim ein ganz besonderer Modetrend: Barchent mit blauen Streifen.
Und das kam so
Es war sehr heiß und die Edelleute wollten sich leichte Sommerüberkleider anfertigen lassen. Deswegen nahm man „Kelsch, eine besondere Art von Barchent mit blauen Streifen, aus dem man für gewöhnlich Bettzeug nähte“. Die übrigen Bewohner Brettens taten es den Edlen gleich, damit sie sich bei einer Erstürmung der Stadt nicht von den Edlen unterschieden. Sie befürchteten, dass sonst die Edlen verschont und die übrigen Bürger getötet werden könnten. Damit taten Sie dem Vogt und den Seinen aber gänzlich Unrecht, denn diese setzten sich über die Maßen für Bretten und seine Bürger ein.
4. Gerberhaus
5. Andris der Bader
6. Saltzhofer Tor
Einer davon war Erpf Ulrich von Flehingen, jung und übermütig. Am Saltzhofer Tor ritt er täglich hinaus vor die Mauer, um die Feinde zu reizen. Und es kam immer wieder zu Scharmützeln zwischen dem Edlen und den feindlichen Söldnern. Nach einigen Tagen durchschauten die Württemberger seine Gewohnheiten und stellen ihm eine Falle. Nur mit Gewalt und Mühe sowie einer gehörigen Portion Glück konnte Erpf Ulrich von Flehingen sich und seine Begleiter wieder hinter die sicheren Mauern Brettheims retten, darunter auch Hans Entenkopf von Neibsheim, der Ulrich als Armbrustschütze zur Seite stand.
7. Saalbachtal
8. Garküche
Die Bürger aus Brettheim und aus den Nachbarorten hielten auf den Mauern Tag und Nacht Wache. Landsknechte unterstützten sie bei der Verteidigung ihrer Stadt. All diese Menschen musste man versorgen.
9. Amthof / Amthaus
Im Amthof war es auch, wo der Vogt mit Hilfe von Oberst Marsilius von Reiffenberg einen Konflikt überwand unter den Landsknechten aus Schedels Haufen und damit letztlich eine größere Meuterei verhinderte. Die Kämpfer hatten seit geraumer Zeit keinen Sold mehr bekommen und machten sich die Zwangslage in Brettheim zunutze, um ihrer Forderung nach Geld Nachdruck zu verleihen. Aber bewaffnete Bürger und Ritterschaft mit ihren Wehren zeigten so starke Präsenz, dass die Landsknechte einlenkten und nach hitzigen Verhandlungen ein Angebot des Vogtes annahmen, wenn auch murrend und knurrend. Letztlich war es auch eine Frage der Landsknechtsehre, treu zu sein und die Stadt Brettheim nicht im Stich zu lassen, obwohl einige „treulose Gesellen“ versuchten, „ihr eigenes Süppchen zu kochen“ und aus der Situation Kapital zu schlagen (s. a. Chronik 13: Herberge von Albrecht Schedel).
10. Gottesacker Tor
11. Haus von Johann Reuther
Clarius Einhart aus Weingarten erstach dort mit einem Sauspieß einen aus dem Oberen Reich (heutige Gegend um Offenburg links und rechts des Rheins). Daraufhin flüchtete er durch die vordere Tür des Hauses von Johann Reuther, einem der reichsten Männer in der Stadt. Viele hatten auf dem dichtbevölkerten Marktplatz diese Tat beobachtet. Die Leute aus dem Oberen Reich kamen mit großem Geschrei herbei und forderten die Herausgabe des Mörders. Clarius, der Täter, aber lief geradewegs zu Reuthers Hintertür wieder hinaus, schlich sich durch das tagsüber immer geöffnete Saltzhofer Tor aus der Stadt und verschwand unbemerkt. Die vom Oberen Reich wollten, dass Johann Reuther den Mörder herausgab. Dieser Aufforderung konnte er natürlich nicht nachkommen und so kam es zum öffentlichen Aufruhr. Unter Gewaltandrohung musste er sein Haus durchsuchen lassen, alle Räume vom Keller bis zum Dach, alle Truhen, Kisten und Schränke. Als sich herausstellte, dass dem Mörder die Flucht gelungen war, mussten die vom Oberen Reich wieder abziehen; unverrichteter Dinge, aber voller Zorn und Trauer.
12. Marktplatz mit Brunnen
Am Freitag Mariä Heimsuchung sammelten sich am Marktplatz auf Befehl von Oberst Marsilius von Reiffenberg in den frühen Morgenstunden 70 Männer aus der Bürgerschaft Brettheims sowie der „verlorene Haufen“ mit 500 Mann an leicht bewaffneten Landsknechten und der „Gewaltige Haufen“ mit 1000 Mann. Diese waren ausgesuchte, kampferprobte und von ihrer Erscheinung imposante Krieger mit Harnisch, Handwaffen und allem ausgerüstet wie es damals üblich war. Der Oberst schickte die drei Gruppen zum Gottesacker Tor, wo sie den Ausfall wagen sollten.
Zum Marktplatz kehrten die Kämpfer nach dem Ausfall zurück und hier wurde dann auch zum guten Ende der Friedensschluss bekanntgegeben, den man zuvor auf dem Reichstag verhandelt hatte.